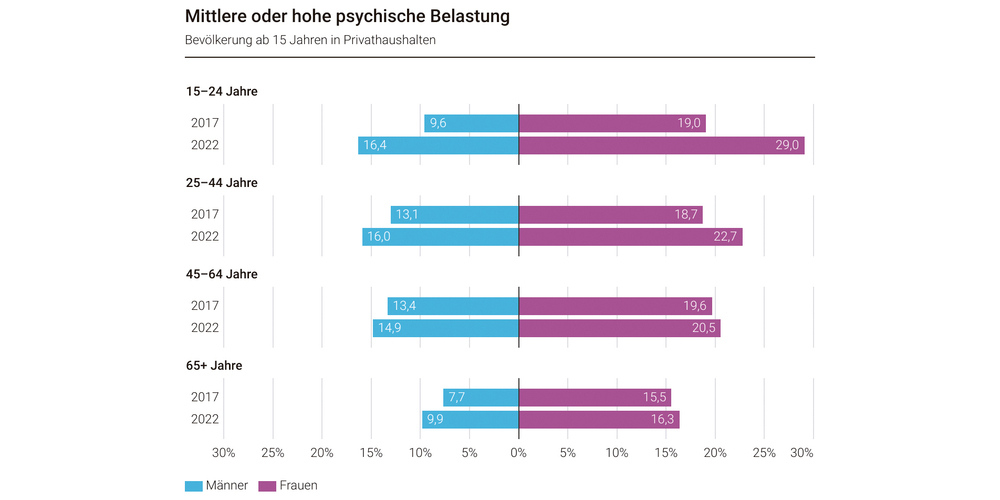Lichterglanz, ausgelassene Stimmung, Glühweinstände, Nachtessen mit Freunden und Familie, Weekendtrip ins wundervoll geschmückte Colmar. So oder ähnlich kann die für viele schönste Zeit des Jahres aussehen – Advent und Weihnachten. Und dann einen Tag auf den nächsten sind die Lichterketten aus, die Feste gehören der Vergangenheit an und ein neues Jahr voller Erwartungen und Hürden beginnt. Der eine oder andere führt Buche oder setzt sich unrealistische Ziele, um mit den teilweise realitätsfremden Social-Media Profilen mitzuhalten. Das Bankkonto ist womöglich auch noch in den roten Zahlen und im Büro flattert eine Hiobsbotschaft ins Hause, die besagt, dass der halben Belegschaft gekündigt wird. Das Resultat ist Stress, Angst oder Selbstzweifel. Und obendrauf scheint auch noch nur selten die Sonne. Willkommen im berühmt berüchtigten «Januarloch». Alles nur ein sich hartnäckig haltender Mythos oder steckt doch eine gewisse Wahrheit darin?
Der vielleicht tristeste Tag des Jahres
Der britische Psychologe Cliff Arnall «erfand» 2005 den «Blue Monday». Dazu stellte er eine Formel auf, die den traurigsten Tag des Jahres berechnen soll. Das Resultat ergab den jeweils dritten Montag im Januar. Also doch. Der Januar ist das dunkle, düstere Tal, bevor es hinauf Richtung Frühling geht. So einfach ist es dann doch nicht. Seine Arbeit wird auch als Pseudowissenschaft angesehen. Unter anderem auch, weil er den «Blue Monday» und dessen Formel erstmalig in einer Medienmitteilung eines Reiseunternehmens veröffentlichte. Also, alles nur Marketing?
Jahreszeit kann Einfluss haben
«Saisonale Akzentuierung, insbesondere depressiver Symptome bei manchen Personen, sind allgemein bekannt und derzeit medial recht populär, obgleich in Diagnosemanualen bisher nicht als eigenständige klinische Bilder geführt», so der 57-jährige Schaffhauser Psychologe Hans Ph. Pletscher. In der psychologischen Praxis seien solche saisonale, atypische melancholische Verstimmungen sehr wohl eine vertraute Tatsache.
«Auch wenn eine Tendenz zur Verschärfung saisonal mitbedingter Stimmungstiefs im Januar oft erwähnt wird, und unter anderem aus den von Ihnen skizierten Gründen auch plausibel erscheinen, lassen meine Erfahrungen in der Praxis keine auffallenden Unterschiede zwischen den Monaten November bis Januar erkennen.» Saisonunabhängig würden gesellschaftliche Normen, obgleich Sie für das Zusammenleben unverzichtbar sind, etwa im Selbstdarstellungs-Wettbewerb sozialer Netzwerke, zu permanentem Zugzwang und dadurch zu Selbstzweifeln und Verunsicherung, mit entsprechend nachteiligen Auswirkungen auf die Affektlage, führen. Dass Menschen, die bereits psychische Probleme hatten, leichter erneut getriggert werden, lasse sich nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten, sagt Pletscher, der seit fast 18 Jahren eine Praxis am Fronwagplatz, Schaffhausen, führt: «Jemand ist nicht jetzt anfälliger, weil er bereits Probleme hatte, sondern weil er allgemein dafür empfänglicher ist.»
Zyklen der Natur ernst nehmen
Bei Ratschlägen verzichte er ganz bewusst auf die Gängigen und durchaus auch Berechtigten. «Gerade saisonal akzentuierte Probleme sollten uns zur Einkehr aufrufen und bewusster werden lassen, dass wir selber ein Teil der Natur sind und dessen Zyklen deshalb ernst nehmen sollten.» Im Konkreten heisse dies etwa, dass im Herbst und Winter ein Herunterfahren und Ruhen in Kargheit von Nöten sein kann, um wieder Kraft zu schöpfen. «Diese innerliche Brache wird durch erzwungene Betriebsamkeit oder Flucht in den Süden umgangen», erklärt der psychologische Spezialist.